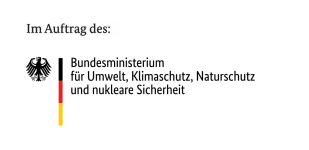PROJEKT
Reduction of CO2 emissions by restoring degraded peatlands in Northern European Lowland (LIFE15 CCM/DE/000138)
-
Das LIFE Projekt Peat Restore bestand aus neun PartnerInnen aus den Ländern Polen, Lettland, Litauen, Estland und Deutschland und hat sich zum Ziel gesetzt, durch Restaurierungsmaßnahmen Moore auf einer Fläche von circa 5.300 Hektar in naturnahe Lebensräume zu entwickeln und somit die natürliche Funktion des Kohlenstoffspeichers wiederherzustellen.
PROJEKT
LIFE Multi Peat (LIFE20 CCMDE001802)
-
Ziel von LIFE Multi Peat ist es zu zeigen, wie degradierte Moore wiederhergestellt werden können. Innerhalb des Projektes werden dazu degradierte Moorlandschaften wiederhergestellt, innovative Restaurationstechniken in einer Datenbank erfasst, ausgewertet und dargestellt, sowie effektive Hilfsmittel zur Mitgestaltung einer zukunftsweisenden Moorschutzpolitik entwickelt werden.
PROJEKT
MoKli
-
Ziel des Verbundprojektes war die Unterstützung der im Klimaschutzplan 2050 anvisierten Einsparung von Treibhausgasen im Sektor Landwirtschaft (Klimaschutz durch Landnutzung). Im Mittelpunkt stand die Entwicklung von regional spezifischen Landnutzungsoptionen, die die Reduzierung und letztlich das Anhalten der Torfzehrung ermöglichen sowie die Beratung zur angepassten, landwirtschaftlichen Nutzung auf organischen Böden.
PROJEKT
Wasserstandsanhebung Günzer See und Renaturierung von Kleingewässern
-
In dem Verbundvorhaben "Vernetzte Vielfalt an der Schatzküste" werden zusammenhängende, strukturreiche Lebensraumnetze für die biologische Vielfalt im Hotspot 29 entwickelt. Langfristiges Ziel ist es, den Rückgang der biologischen Vielfalt im Projektgebiet, durch das Zusammenspiel von intakten Lebensräumen mit vernetzten Biotopen und kommunaler Biodiversität, zu verringern. Unter anderem durch die Wiederherstellung von Kleingewässern und Küstenniedermooren werden wichtige Biodiversitätstrittsteine im geplanten Biotopverbund geschaffen. Gleichzeitig werden auch deren ursprüngliche Fähigkeiten als Kohlenstoffspeicher und Nährstoffsenken wiederbelebt.
PROJEKT
Paludi-PRIMA
-
Das Verbundprojekt Paludi-PRIMA (FKZ: 22026017 und FKZ: 22032718) untersuchte mit Schilf und Rohrkolben einheimische Pflanzenarten, die an wassergesättigte Böden angepasst sind, den Torferhalt ermöglichen und durch die stoffliche Verwertung der Biomasse ein hohes Wertschöpfungspotential haben. Paludi-PRIMA sollte dazu beitragen, Paludikultur auf Niedermoorstandorten in die Praxis zu bringen.
PROJEKT
Naturschutzgroßprojekt
-
Hier geht es um Schutz und Entwicklung eines vielfältigen Lebensraummosaiks aus Gebirgsbächen, eingestreuten Mooren, Bergwiesen sowie Buchen- bzw. Bergmischwäldern im UNESCO-Biosphärenreservat Thüringer Wald. Übergeordnetes Ziel des Projektes ist es, die Lebensraumqualität der Bäche, Moore und Bergwiesen im Gebiet zu fördern bzw. zu erhalten. Naturferne Gewässerabschnitte sollen renaturiert, degradierte Moore revitalisiert, verbuschte Bergwiesen wiederhergestellt sowie nachhaltige Nutzungskonzepte entwickelt werden. Als lebensraumübergreifende Leitart gilt der Schwarzstorch.
PROJEKT
Miteinander für Moore und mehr
-
Mit seinem Hotspot-Projekt möchte der NABU Baden-Württemberg, durch investive Naturschutzmaßnahmen und eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit, die biologische Vielfalt im Hotspot stärken und weiterentwickeln. Des Weiteren geht es um eine engere Vernetzung der Akteure, die mit Naturschutz und Landnutzung in der Hotspot-Region zu tun haben, sowie um die Aufwertung und bessere Vernetzung ökologisch besonders wertvoller Feuchtlebensräume.
PROJEKT
Naturschutzgroßprojekt
-
In diesem Projekt geht es um die Wiedervernässung entwässerter Moore im Osterzgebirge und die Wiederherstellung von Moorrandbereichen. Unter anderem sollen dadurch auch Nahrungshabitate des Birkhuhns geschützt werden.
PROJEKT
Renaturierung von Moorlebensräumen auf der Bergischen Heideterrasse
-
Im Projektgebiet werden insbesondere durch den Verschluss von Entwässerungsgräben Moorstandorte in ihrer hydrologischen Situation verbessert und wiedervernässt. Die unterschiedlichen Moorlebensräume werden so aufgewertet und in ihrer Funktion als besonderes Habitat und Träger von Ökosystemleistungen gesichert. Die lokale und regionale Bevölkerung arbeitet aktiv an der Maßnahmenumsetzung mit und wird durch diese Einbindung für die Bedeutung von Moorlebensräumen sensibilisiert.
PROJEKT
Alpenmoore II
-
Übergeordnetes Ziel des Projektes ist es, eine Methodik für die Ableitung von Klimaschutzpotenzialen in Alpenmooren zu entwickeln und die Akteur*innen für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen zu vernetzen.
Seitennummerierung
- Vorherige Seite
- Seite 7
- Nächste Seite