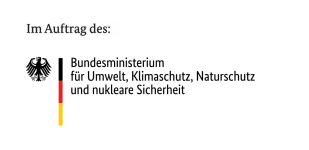© by studio | Adobe Stock
27 Erkenntnisse werden angezeigt
PROJEKT
Wärmere Bedingungen erhöhen die Treibhausgasemissionen im intensiven Grünlandsystem. Die Umstellung der Bewirtschaftung auf Paludikultur (Seggen) führt zu Treibhausgas-Reduktionen, die einen Netto-Kühlungseffekt mit einer Aufnahme von ca. 10 t CO₂-eq ha-1 yr-1 bewirkt. Die starke Kohlenstoff-Senke könnte bei einer Erwärmung beibehalten werden. Wiedervernässte Moorböden mit angepassten Pflanzenarten unterstützen die Treibhausgasminderung und können die Widerstandsfähigkeit von Ökosystemen auch unter dem Klimawandel fördern. In einer wärmeren Welt sollten Anpassungsmaßnahmen für organische Böden daher eine Änderung der Bewirtschaftung in Richtung Paludikultur beinhalten.
PROJEKT
Durch Wiedervernässungsmaßnahmen, die im Rahmen des bayerischen Programms zur Moorrenaturierung KLIP durchgeführt wurden, konnten auf über 1.000 ha seit 2008 rund 200.000 t CO₂-Äquivalente eingespart werden. Für 2020 gilt: Bayerns organische Böden emittieren: 6,7 (5,7-7,3) Mio. t CO₂-Äquivalente a-1. Für die Berechnung der Einsparleistung ist die Kenntnis über den durchschnittlichen Flächen-Jahreswasserstand zentral. Da nicht immer gemessene Pegelstände zur Verfügung stehen, kann Vegetation als Proxy dienen.
PROJEKT
Mit den durch das bayerische Programm zur Moorrenaturierung KLIP 2020 geförderten Projekten konnten im Zeitraum von 2008 bis 2015 etwa 60.000 t CO₂-Äquivalente eingespart werden und naturschutzfachliche Ziele erreicht werden. In Bezug zu dem Mitteleinsatz ergeben sich bei einer 50-Jahres-Berechnung Vermeidungskosten von ca. 30 Euro / t CO₂.
PROJEKT
Niedermoorpaludikulturen weisen die aktuell höchste empirisch nachgewiesene Klimaschutzleistung aller Maßnahmen zur Minderung von Treibhausgas-Emissionen im Landnutzungs-Sektor auf und können vermutlich als eine der effizientesten und kostengünstigsten natürlichen Klimaschutzlösungen angesehen werden. Dämm- und Baustoffplatten, Verpackungsmaterialien sowie biobasierte Kunststoffe scheinen am vielversprechendsten in der Nutzung der anfallenden Biomasse zu sein. Aktuell ergeben sich aufgrund des Fehlens marktetablierter Veredelungsprodukte aber noch negative Deckungsbeiträge.
PROJEKT
Durch fortschreitende Torfsackung ist die Landwirtschaft auf bayerischen Moorböden endlich. 25 % der landwirtschaftlichen Nutzflächen (v. a. Ackerbau) auf Moorböden erreichen innerhalb von 15 Jahren die Grenze der Bewirtschaftbarkeit, 38 % innerhalb von 30 Jahren. 70.000 Hektar Moorböden in Bayern haben günstige sozioökonomische Ausgangsbedingungen für den Klima- und Moorbodenschutz. Bei 90.000 Hektar gibt es sozioökonomische Hürden.
PROJEKT
Die Projektergebnisse werden 2024 vorliegen. Als Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass sich das bisher auf der Versuchsstation Karolinenfeld eingesetzte Schachtsystem gut zur Wasserregelung der Fläche eignet. Die Umwandlung von Acker in Feucht- oder Nassgrünland sollte im Herbst, vor einer Wasserstandsanhebung erfolgen. Im Vergleich zu Weißklee und Deutschem Weidelgras kommen Rohrschwingel und Rohrglanzgras gut mit den Stauwasserbedingungen eines Niedermoorstandortes mit Oberbodendegradation zurecht. Bei Seggen zeigte sich bisher die Anpflanzung als deutlich zuverlässigere Etablierungsform als die Ansaat. Zudem muss der Wasserstand zügig angehoben werden, um den Seggen die nötige Konkurrenzkraft gegenüber den Beikräutern zu verschaffen. Beim Einsatz von Landtechnik auf wiedervernässten Flächen ist mit einem erhöhten Arbeitszeit-, Reparatur- und Wartungsaufwand, sowie mit der Beschaffung spezialisierter Verfahrenstechnik zu rechnen. Als Absatzmöglichkeiten für das Paludikulturmaterial zeichnen sich insbesondere der Bausektor sowie die Papier- und Kunststoffindustrie ab. Die Treibhausgasbilanz der untersuchten Bewirtschaftungsformen kann erst gegen Projektende errechnet werden, wenn die Messungen abgeschlossen sind.
PROJEKT
In Niedersachsen sind ungefähr 500.000 ha (ca. 10 % der Landfläche) von organischen Böden, insbesondere Hoch- und Niedermooren, bedeckt (laut niedersächsischer Bodenkarte (BK50)). Die meisten Flächen sind entwässert und unter Nutzung. Dadurch werden große Mengen Treibhausgase emittiert und viele Ökosystemleistungen nicht mehr erbracht. Daher ist Paludikultur eine nachhaltige Alternative.